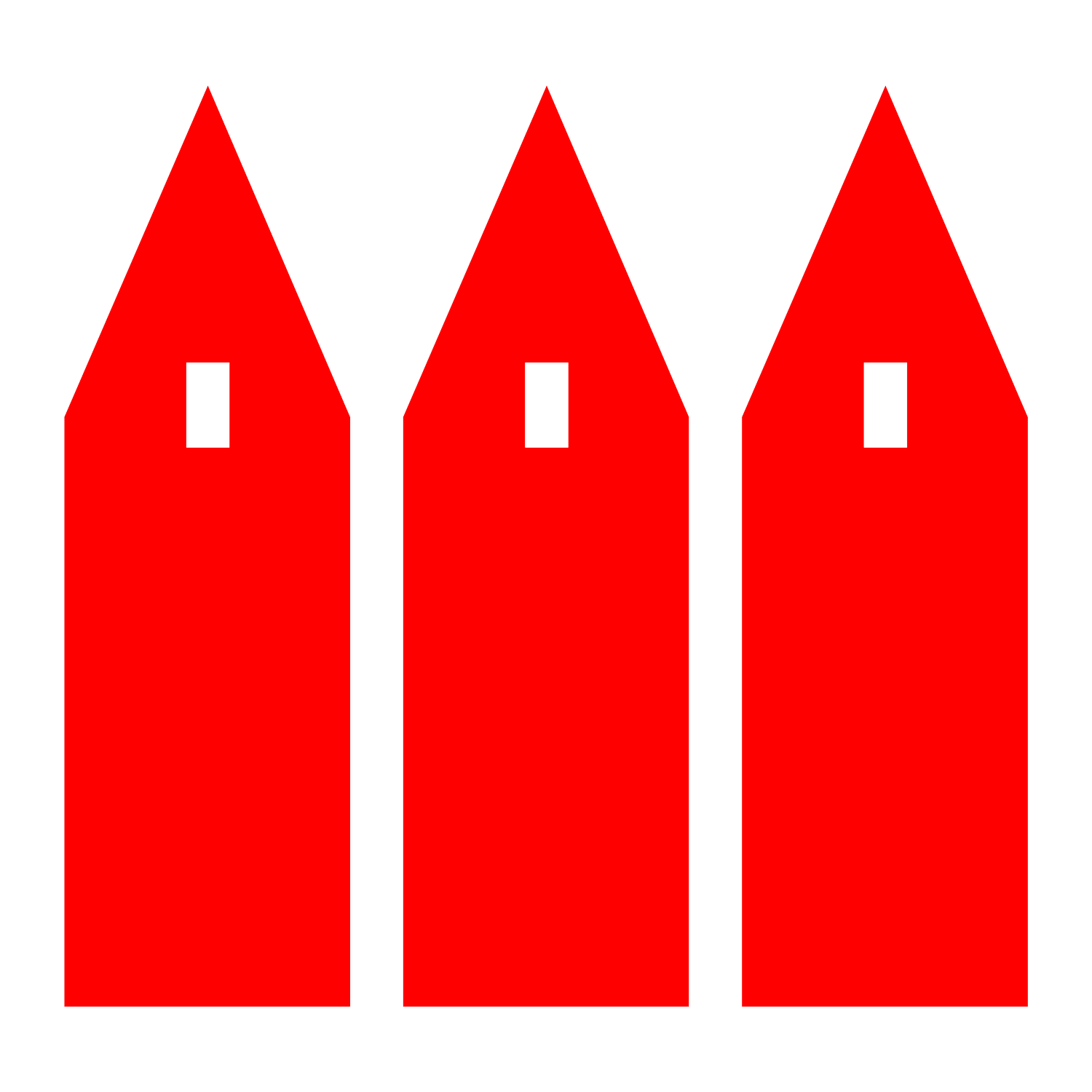FÜNF BEDINGUNGEN ZUR SCHÖNHEIT DER STADT IN FÜNF MINUTEN
Es gibt ein kollektives Gespür für die Schönheit der Stadt. Was also sind die grundlegenden Voraussetzungen für einen menschenwürdigen schönen Städtebau?
Es gibt ein kollektives Gespür für die Schönheit der Stadt. Was also sind die grundlegenden Voraussetzungen für einen menschenwürdigen schönen Städtebau?
Wenn uns jemand strahlend davon berichtet, dass er nach Florenz fährt, so meint er nicht etwa die Neubauviertel, sondern er spricht von der Stadt der Medici, vom Zentrum der Stadt also. Das gleiche gilt für jede andere unserer europäischen Städte, denen wir einen Besuch abstatten. Es gibt also offenbar ein kollektives Gespür für die Schönheit der Stadt, sonst könnte mit der Aussage „nach Florenz“ zu fahren vielleicht auch ein Neubauviertel am Rande des alten Zentrums gemeint sein.
Dieses kollektive Gespür lässt uns die Schönheit einer Stadt wahrnehmen – wir können uns in einem städtischen Raum wohl fühlen, erklären aber, was Ursache für unser Wohlbefinden ist, vor allem aber welcher Kriterien es bedarf, einen schönen Stadtraum zu entwerfen, damit wir uns in ihm wohl fühlen, können wir ohne ein gründliches Studium der europäischen Stadt und ihrer Architekturen nicht. Und dies sollte als Chance gesehen werden. Es bedeutet aber auch, dass das Wissen um die Schönheit der Stadt nicht durch ein Befragen der Bürger ersetzt werden kann. Schöne Stadträume sind nicht nur mit Beteiligungsprozessen zu entwickeln. Und wenn der Text von Bedingungen zur Schönheit der Stadt spricht, so stellt er aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Was also sind die grundlegenden Voraussetzungen für einen menschenwürdigen schönen Städtebau?
1. SCHÖNHEIT DURCH RAUMBILDUNG
Eine der ersten Bedingungen für die Schönheit der Stadt stellt die konkrete räumliche Fassung ihrer öffentlichen Straßen und Plätze dar. Diese erfolgt durch die Häuser, die die Straßen und Plätze einfassen und sie zu Räumen, zu Straßen- und Platzräumen werden lassen.
Wie der Wohnraum, in dem die Familie zusammenkommt, so ist der Platzraum der Ort, an dem sich die Bewohner der Stadt treffen, feiern, demonstrieren oder sich einfach nur zufällig begegnen. Der städtische Raum hat damit also auch eine soziale Funktion, die in dem Bemühen heutiger Stadtplanung völlig unterschätzt wird.
Und wie man einen Wohnraum mit zu vielen Öffnungen als ungemütlich und damit als unschön empfindet, so fühlt sich dies für den Bewohner einer Stadt auch im ungeordneten, ungefassten Stadtraum an.
Die Schönheit der Stadt hat also nicht nur etwas mit der Ästhetik ihrer Häuser zu tun. Vielmehr ist die Raumbildung eines ihrer wesentlichen Kriterien. Das Nichtvorhandensein der Raumbildung in unseren Neubauvierteln lassen diese deshalb auch weniger attraktiv erscheinen als die Räume alter Stadtteile, wie wir sie beispielsweise in Bornheim, Bockenheim oder Sachsenhausen finden.
2. SCHÖNHEIT DURCH LEBENDIGKEIT
Darüber hinaus bedarf es weiterer Kriterien des Städtebaus, auf die an dieser Stelle nur kurz eingegangen werden kann, die aber von besonderer Wichtigkeit für die Lebendigkeit der Stadt sind. Es sind dies die Dichte, die soziale Vielfalt und die funktionale Mischung.
Das vielfältige Leben im öffentlichen Raum entsteht durch die funktionale Mischung, wie sie beispielsweise in der Schweizer Straße in Sachsenhausen oder dem Oeder Weg im Nordend Frankfurts zu finden sind. In diesen Straßen wird gewohnt und am Tage auch gearbeitet. Startups, Backstuben, Werkstätten in den rückwärtigen Anbauten und Höfen bilden die Keimzelle städtischen Lebens in den Straßen unserer Städte. Und natürlich bedarf es auch einer gewissen Dichte, wie wir sie in den genannten Straßen finden. Eine Metzgerei oder ein Restaurant beispielsweise können nur dort existieren, wo viele Menschen leben und arbeiten. Im Zeitalter des Autoverkehrs sind wir darüber hinaus auf funktionsfähige Straßen angewiesen. Dies gilt vor allem in kleinen Städten, wie Frankfurt, die ohne ihr Umland nicht lebensfähig sind.
3. SCHÖNHEIT DURCH REIHUNG UND SYMETRIE
Mit den 68er Jahren sind die Begriffe „Reihung und Symmetrie“ in der Stadtplanung in Verruf geraten. Für das menschliche Auge aber erfüllen Reihung und Symmetrie ein wesentliches Kriterium der Schönheit.
Bäume, die in regelmäßigem Abstand voneinander gepflanzt werden, können einen Straßenraum mit hässlichen Häusern zu einer prachtvollen Allee werden lassen.
Einen der schönsten Räume, die durch Reihung und Symmetrie entstanden sind, findet sich in Sachsenhausen am Schaumainkai. Im Abstand von knapp 6 Metern stehen in einer Länge von eineinhalb Kilometern auf dem Hoch Kai doppelreihig geschnittene Platanen und prägen das Bild der Stadt Frankfurt am Main. (Da es sich um geschnittene Platanen handelt, bedürfen sie einer dauerhaften jährlichen Pflege, ohne die die Schönheit einer Stadt prinzipiell nicht auskommt!)
Dem vergleichsweise niedrigen Platanendach setzte man seinerzeit in der Planung hochgewachsene Pappeln entgegen. In Symmetrie gepflanzt und hoch aufragend markierten die Doppelpaare die Abgänge zum Main und rhythmisierten bis zu ihrer Fällung in den 1970er Jahren das lange Band der Platanenallee.
4. SCHÖNHEIT DURCH MATERIAL UND FARBE
Die Schönheit des städtischen Raumes wird durch die Straßenfassade eines Hauses bestimmt und benötigt „dauerhafte“, nicht aber „nachhaltige“ Fassaden.
Schon aus ökologischen Gründen und auch das kann hier nur beiläufig erläutert sein, sollten Aluminium- Glasfassaden nur in Ausnahmefällen Anwendung finden. Ihr Energieaufwand bei der Herstellung ist immens, vor allem aber ist der Energieeintrag in das Gebäude um ein Vielfaches größer als bei herkömmlichen Stein- und Putzfassaden mit einer angemessenen Befensterung.
Die Schönheit eines Stadtbildes wird für den Betrachter auch durch die Gewohnheit an den immergleichen Ort bestimmt. Man stelle sich nur einmal vor, die Häuser des Mainprospektes wären mit Aluminium-Glasfassaden versehen worden. Dies hätte zur Folge gehabt, dass sich das Aussehen der Stadt am Main in den vergangenen Jahrzehnten ständig verändert hätte. Die Schönheit liegt hier im Erhalt des Stadtbildes am Main mit seinen weiß verputzten Häusern. Trotz Kriegszerstörungen und der Ergänzung mit den Häusern des klassizistischen Fischerfeldviertels, das nach einem Baustatut von 1809 nach den Prinzipien des Klassizismus errichtet wurde, hat sich das Aussehen des weiß verputzten Frankfurter Mainprospektes kaum verändert.
Die Frankfurter Brücken über den Main sind mit rotem Mainsandstein verkleidet und werden durch Stahlteile in grüner Eisenglimmerfarbe ergänzt. Es gibt nur diese beiden Farben. Material und Farbe aller Brücken über den Main bilden damit einen Ensemble-Charakter und tragen zur Schönheit der Flusslandschaft bei. Wie sehr andere Farbtöne diese Einheit zerstören, lässt sich in der Überlegung studieren, den Eisernen Steg in roten, weißen und blauen Farbtönen zu streichen, also in den Farben des 1990 errichteten Holbeinstegs.
5. SCHÖNHEIT UND SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Das Beispiel Holbeinsteg zeigt, wie wichtig das städtebauliche Verständnis für einen Ort ist, bevor der Architekt oder der Ingenieur zu arbeiten beginnt. Nicht die persönliche Vorliebe für bestimmte Formen, Farben und Materialien, sondern das Bewusstsein für den Ort und seine Geschichte lassen ein Bauwerk zum Teil eines städtischen Ganzen werden und tragen damit zur Schönheit des Wohnraumes Stadt bei.
Erschienen im Journal Frankfurt Nr. 04/2025
Leadership AWARD des Urban Land Institute Germany in der Kategorie Stadtplanung für Christoph Mäckler
Dem Direktor und Gründer unseres Instituts, Christoph Mäckler, wurde am 21. November 2024 im Rahmen eines festlichen Galadinners im Wintergarten Varieté der Leadership AWARD des Urban Land Institute Germany in der Kategorie Stadtplanung verliehen. Wir sind stolz und freuen uns!
Christoph Mäckler wurde am 21. November 2024 im Rahmen eines festlichen Galadinners im Wintergarten Varieté der Leadership AWARD des Urban Land Institute Germany in der Kategorie Stadtplanung verliehen. Wir sind stolz und freuen uns!
Christoph Mäckler dankt dem ULI „auch im Namen von Paul Bauwens-Adenauer, Barbara Ettinger-Brinckmann, Hans-Christian Hauck, Franz-Josef Höing, Ulrich Höller, Marco Knopp, Hilmar von Lojewski, Elisabeth Merk, Reiner Nagel, Jens Weidmann, Cornelia Zuschke und weiteren Persönlichkeiten, die das Institut im Vorstand, im Kuratorium und im wissenschaftlichen Beirat unterstützen. Stadt benötigt wieder den städtebaulichen Entwurf!“
Interview Brichta & Bell - der ntv Wirtschafts-Podcast mit Christoph Mäckler
Paris ist Vorreiter beim Thema Verkehrswende. Auch viele Städte in Deutschland denken über Wege nach, um das Auto langfristig aus der Innenstadt zu verbannen. Aber ist das der richtige Ansatz? Darüber haben die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell mit dem Stadtplaner und Architekten Christoph Mäckler gesprochen. Er warnt vor Ideologie und spricht sich für individuelle Konzepte aus.
Sind autofreie Städte die Zukunft?
Paris ist Vorreiter beim Thema Verkehrswende. Keine Stadt in Europa geht so intensiv gegen den Autoverkehr in der Innenstadt vor wie die französische Hauptstadt. Auch viele Städte in Deutschland denken über Wege nach, um das Auto langfristig aus der Innenstadt zu verbannen. Aber ist das der richtige Ansatz? Darüber haben die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell mit dem Stadtplaner und Architekten Christoph Mäckler gesprochen. Er warnt vor Ideologie und spricht sich für individuelle Konzepte aus.
Arte: Schön oder hässlich? Wenn Architektur polarisiert
Langweilig und monoton! Christoph Mäckler zeigt, was in Neubauvierteln falsch läuft.
Neu gebaute Wohngebiete in deutschen Städten sehen – wie man es oft hört – alle gleich aus und werden als austauschbar und monoton beschrieben. Warum ist das so? Wie könnte man sie besser machen? Und mehr Lebensqualität für die Bewohner schaffen? Christoph Mäckler hat Antworten und stellt seine Vision einer lebensfähigen und schönen Stadt in einem Film von ARTE vor: DIE GARTENHOFSTADT
Langweilig und monoton! Christoph Mäckler zeigt, was in Neubauvierteln falsch läuft.
Neu gebaute Wohngebiete in deutschen Städten sehen – wie man es oft hört – alle gleich aus und werden als austauschbar und monoton beschrieben. Warum ist das so? Wie könnte man sie besser machen? Und mehr Lebensqualität für die Bewohner schaffen? Christoph Mäckler hat Antworten und stellt seine Vision einer lebensfähigen und schönen Stadt in einem Film von ARTE vor: DIE GARTENHOFSTADT
Der Film mit Christoph Mäckler aus der Reihe „Arte Twist” wird am 29.09.2024 um 9:40 Uhr auf ARTE ausgestrahlt und steht ab heute in der ARTE-Mediathek bereit.
Stadtraum und Fachkompetenz
14. Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, 7./8.05.2024 – Ein Rückblick
von Matthias Frinken
14. Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, 7./8.05.2024 – Ein Rückblick
VON MATTHIAS fRINKEN
Ausgangspunkt zur Vorbereitung der 14. Konferenz des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst Frankfurt / M. in der Düsseldorfer Rheingoldhalle von Wilhelm Kreis (1926) war das Unbehagen darüber, dass in unseren Städten immer wieder Diskrepanzen festzustellen sind zwischen formu-lierten stadtplanerischen Zielvorstellungen und dann tat-sächlich umgesetzten städtebaulichen Realitäten. Dies gilt für die bauliche Weiterentwicklung innerstädtischer Bestandsquartiere ebenso wie für viele Neubauquartie-re. Zu beklagen sind in der Lehre zu wenig ausformulier-te Städtebau-Angebote und in der kommunalen Praxis zu wenig korrigierende städtebauliche Expertise und Beratung in Planungs- und Genehmigungsprozessen. Zu oft wer-den außerdem städtebauliche Zielsetzungen während der Umsetzungsphase von technischen Fachplanungen konter-kariert, vor allem durch den Sektor Verkehrsplanung.
Auf früheren Konferenzen wurden in der „Kölner Erklärung“ 2014 oder der „Düsseldorfer Erklärung“ 2019 bereits sehr ähnliche Kritikpunkte an dem Umfeld der eige-nen Städtebau-Disziplin zusammengefasst. Das provozierte jeweils lautstarke Gegendarstellungen von vielen Fachkol-leg:innen. Letztlich haben die Planungsdisziplinen profitiert von diesen teils vehement geführten Argumentationen in den letzten Jahren. Jedoch hat eine gewisse Polarisierung stattgefunden zwischen einer ästhetisch-stadtbaukünstleri-schen und einer eher an Beteiligung, Verfahren und Ergeb-nisoffenheit orientierten Planungsauffassung, die sich einer konkreten städtebaulichen Steuerung eher entzieht. Die 14. Konferenz hatte sich das Ziel gesetzt, die aktuellen Ten-denzen erneut zu beobachten sowie eine höhere Ausbil-dungsqualität und Zielorientierung bei der Herstellung qua-litätvoller städtebaulicher Räume zum wiederholten Male anzumahnen.
Ein wesentlicher Forschungsgegenstand des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst ist die „Europäische Stadt“, die in unserem Kulturraum geprägt ist von einer Trennung öffentlicher und privater Räume, von Plätzen und Straßen-räumen mit qualitätvollen Rändern – eben Fassaden von Bürgerhäusern auf deutlich ablesbaren Parzellen, kleinteili-ger Nutzungsmischung und damit einer großen Vielfalt an beteiligten und gestaltenden Akteuren.
Die Maßstäblichkeit ist bestimmt von Rathäusern und Kirchen als sogenannten Hochpunkten, Märkten und Topografie. Darüber hinaus werden die schnell wachsen-den Städte des 19. Jahrhunderts mit ihren Blockstrukturen sowie auch Stadttypologien außerhalb des Spektrums der streng funktionalistischen Moderne untersucht. Dies wird durch Analysen historischer und auch moderner und aktu-eller Stadt-Typologien in einer Vielzahl von Veröffentlichun-gen belegt.
Die Konferenz I
Vor diesem Hintergrund erfolgten auf der Konferenz das Eingangsstatement und die fachlichen Inputs der Veranstal-ter. Das Postulat nach klaren städtebaulichen Raumbildun-gen als sozialen und Begegnungsräumen in den Städten wird ergänzt um jüngere Forschungsergebnisse des Insti-tuts zu städtischen Gebäudetypen, die diese unterstützen können. Hinweise auf Wohnumfelder und Erschließungs-flächen belegen zusätzlich, wie wichtig das Entwerfen und die Herstellung von Stadträumen für das Wohlbefinden, Zusammenleben und Agieren in der Stadt sind. Die Not-wendigkeit kompakter und dichter Bauweisen in Quar-tieren mit eindeutigen öffentlichen Straßenräumen sowie grünen Innenhöfen mit Nischen für Privatheit, Erholung und Spiel wird hervorgehoben. Insbesondere im Mietwoh-nungsbau ist zu beklagen, dass solche Räume kaum noch eine Rolle spielen im rationalisierten Planungs- und Baupro-zess mit glatten Fassaden vorn und hinten und hunderten gleicher Fensterformate. Auch die in letzter Zeit favorisier-ten sog. Hybriden Städtebaulösungen haben ihre Tücken – oft muss Verkehr tief in Blöcke hineingezogen werden, und es entstehen eben keine öffentlichen und privaten Räume.
In den Beiträgen aus dem Umfeld der Hochschulen wird die Ausbildungssituation im Fach „Städtebau“ beleuchtet. Tatsächlich werden mittlerweile gut 50 Ausbildungs- und Studiengänge zu Architektur und Stadtplanung, Raumord-nung und Stadtforschung angeboten. Vielfach ist es mög-lich, diese Studiengänge zu absolvieren, ohne sich jemals mit einem städtebaulichen Entwurf zu befassen. Oft stehen die Erforschung der Komplexität von Stadt, rechtliche oder Verfahrensfragen sowie natürlich auch soziale, gesundheit-liche, funktionelle oder kulturelle Themen im Mittelpunkt. Die Stadt als gebauter Raum kommt da oft zu kurz. Die Betrachtung von Daten und auch die Begleitung von formellen und informellen Planungs- und dialogorientierten Verfahren bedeutet aber längst nicht, dass Stadträume entwickelt werden können oder ein Verständnis für die Ele-mente europäischer Stadtbaukultur entsteht.
Das Städtebaureferendariat ist ebenfalls vorrangig auf die Vermittlung rechtlicher Aspekte der Stadtplanung aus-gerichtet. Die Kammern der Länder weisen jedoch darauf hin, dass erst der Nachweis einer längeren Berufspraxis dazu befähigt, überhaupt auf deren Stadtplaner-Listen zu kommen. Spätestens dort wird auch eine gewisse Städte-bau-Kompetenz abgefragt.
Aus den teilnehmenden Kommunen an der Konfe-renz wird sehr unterschiedlich auf diese Ausgangsthesen reagiert. Manche betonen (z.B. Düsseldorf), dass sie einen sehr motivierten und interessierten Nachwuchs aus den Hochschulen begrüßen können. Andere beklagen, dass im Alltag der Erledigung der kommunalen Pflichtaufgaben für eine vertiefende Beratung zu städtebaulichen Gestaltungs-fragen einfach kaum Zeit bleibt. Das gilt dann auch für eine kontinuierliche eigene Weiterbildung, für die Betreuung externer Expertise in Form von Gestaltungsbeiräten oder einer Schwerpunktbildung auf städtebauliche Gestaltungs-fragen in internen integrierten Arbeitsprozessen.
Exkurs: städtebauliche Dichte
Ein besonderer Aspekt, der im Zusammenhang mit einer Neubesinnung auf Städtebau und Stadtbaukunst durch das Institut mit angestoßen wurde, war und ist eine kriti-sche Betrachtung der normativen Gegebenheiten für den Umgang mit einer städtebaulichen Dichte. Nachdem es in der Stadtbaugeschichte in der Zwischenkriegszeit und auch später eine erhebliche Kritik an den oft überbelegten und mit störendem Gewerbe durchzogenen gründerzeitlichen Mietwohnungsbau in Baublöcken gab, dokumentiert z.B. durch Manifeste wie die „Charta von Athen 1933“ oder auch Texte zur „Gegliederten und aufgelockerten Stadt“, Göderitz u.a. 1957, wurden in den 1960er Jahren die gesetzlichen Grundlagen dafür festgelegt, Städtebau bis heute nur noch mit relativ geringen Dichten zuzulassen. Mit den geringen Dichtewerten wurden aber Rechenmo-delle zur Bodennutzung fixiert, die der historischen, sozi-alen, kulturellen und auch ökonomischen Komplexität der europäischen Stadt in keiner Weise gerecht wurden. Schon bald gab es daher erhebliche Kritik, die hier nur ansatz-weise mit dem Hinweis auf die o.g. „Düsseldorfer Erklä-rung“ 2019 angedeutet werden kann. Heute gibt es kaum noch Überbelegung im Mietwohnungsbau oder Toiletten auf halber Treppe, auch keine Fabriken im Innenhof. Wir können und müssen daher innerstädtische Block- und Hofstrukturen mit kleinteiligen Parzellierungen neu den-ken. Die „Kreuzberger Mischung“ kann da als positives Bild herangezogen werden, ein Nebeneinander von heute nicht störendem Gewerbe in den Höfen ebenso wie neu-en Wohnformen mit Start-ups, Homeoffice, Wohngruppen und multikultureller Vielfalt dicht nebeneinander.
So bleibt als ein Grundthema der Stadtbaukunstkonfe-renzen die Frage bestehen, inwiefern die Rückbesinnung auf klare Raumstrukturen zwingend als Grundlage für eine Neubewertung der Erfahrungen mit der europäischen Stadt gelten kann – oder ob sich die gebaute Stadt eher wie von selbst in Varianten und fließend aus Dialog, Betei-ligung und Abwägung ergibt. Nach Meinung des Verfas-sers ist beides notwendig, um sich als Bürger frei, sicher und gesund im städtebaulichen Raum bewegen, diesen konfliktfrei nutzen und sich entfalten zu können. Nach den Leitbild- und Beteiligungs-Dialogen muss der urbane Raum abgeleitet und entworfen werden. Die Erfüllung der verbal formulierten Ziele im Raum ist absolut als Stadtbaukunst anzuerkennen. Insbesondere die Herstellung eindeutiger öffentlicher und privater Räume muss hier im Vordergrund stehen.
Leider werden in manchen kritischen Beiträgen diese Positionen gegeneinander ausgespielt, indem die Städ-tebauer als konservativ, die ergebnisoffen und prozess- orientierten Planungsansätze dagegen als demokratischer bezeichnet werden. Beiden „Lagern“ wird aber gleichzeitig durchaus attestiert, sich in den Traditionen der europäischen Stadt und ihrer kulturellen Werte zu bewegen.
Der Verfasser möchte daher an dieser Stelle auf eine ganz andere Art konservativen Stadt- und Städtebau-Ver-ständnisses aufmerksam machen. Das tritt z.B. darin zu Tage, wenn mit Bezug auf Planungsinstrumente wie die BauNVO mit allen juristischen Tricks in sogenannten Reinen Wohngebieten Kindertagesstätten oder Flüchtlingsunter-künfte verhindert werden sollen oder in Kerngebieten in den Innenstädten trotz Leerstands ganzer Blöcke zur Siche-rung hoher Bodenwerte die Integration von mehr Wohn- oder Mischnutzungen behindert wird.
Unsere Instrumente müssen also in Bezug auf Dichte, Mischung, eventuelle temporäre Erfordernisse flexibler handhabbar werden. Eine Stadt ist immer in Bewegung, in Veränderung begriffen. Sie lebt durch Brüche, Vielfalt, Widersprüche, ist eigentlich immer ein Ort der Mischung. Eine einzige monofunktionale oder technologische Kategorie reicht nicht aus, um das Bild der europäischen Stadt zu beschreiben oder zukunftsfähig zu gestalten.
Die Konferenz II
In den konkreten Beiträgen aus den teilnehmenden Kom-munen werden auf der Konferenz Beispiele vorgestellt, die Wege eines integrierten Planungsprozesses mit intensiver Beteiligung bis hin zur städtebaulichen Umsetzung auf-zeigen. Dabei sind jeweils diejenigen Beispiele besonders beeindruckend, in denen die Kommunen selbst über den Grund und Boden verfügen, den Planungsprozess steuern und auch selbst eine Parzellierung, die Grundstücksver-gabe und Gestaltungsvorgaben definieren und einhalten. Hier wären vorrangig zunächst die Beispiele aus Ham-burg, Münster und Nordhorn zu nennen, um gleich meh-rere Größen von Städten und Gemeinwesen zu berück- sichtigen.
Allen Teilnehmern ist jedoch auch bewusst, dass es parallel zu den vorgestellten guten Projekten und Planun-gen immer auch Gegenbeispiele in den Städten gibt, z. B. wenn städtebauliche Verträge nicht eingehalten werden oder Investoren versuchen, Partikularinteressen durchzu-setzen, die nicht oder kaum an Gemeinwohl, Schönheit oder Lebensfähigkeit von Stadt orientiert sind. Wie bereits gesagt, die Stadt lebt nicht nur von Widersprüchen und Brüchen – sie muss diese auch aushalten und verhandeln.
So sollen einige kleine Stichworte als Fazit festgehalten werden:
Die bislang 14 Konferenzen des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst belegen die Zielsetzung, Städtebau in Deutschland „alltagstauglich, wertvoll und schön“ anzulegen, wie die Frankfurter Rundschau schon 2010 nach der ersten Konferenz festgestellt hat.
In der Ausbildung von Architekten, Stadtplanern und anderen raumbezogenen Planungsberufen müssen Städtebau und Stadtbaugeschichte einen höheren Stellenwert erhalten.
Das gilt auch für die Ausbildung in den Berufsbildern der Immobilienwirtschaft.
Es ist mehr Forschung anzulegen in Fragen der Zusammenhänge von Stadttypologien und sozialem Leben, Wohlbefinden und Lebensqualität.
Es ist ebenso zu beforschen und zu begleiten, ob und inwiefern die jüngere Fortschreibung der Planungsin- strumente mit höheren Dichten (Urbane Gebiete) zu besseren städtebaulichen Lösungen mit höherer Lebensqualität führt.
Die Zusammenhänge zwischen integrierten Planungsprozessen, der Erarbeitung von Leitbildern und komplexen Handlungskonzepten und in der Folge tatsächlich realisierten städtebaulichen Räumen sind intensiver zu reflektieren und zu kommunizieren.
Matthias Frinken, SRL, Hamburg, Wiss. Beirat des Instituts für Stadtbaukunst
Die Ergebnisse der 14. Konferenz werden 2025 veröffentlicht. Ein Termin und ein neuer Ort für die 15. Konferenz stehen bereits fest: 1. / 2. Juli 2025 im Poelzig-Bau der Goethe-Universität in Frank-furt / Main.
Podiumsdiskussion KON14: Wer baut die Städte der Zukunft?
Neubau wird künftig die Ausnahme sein und das Modell des Stararchitekten ist überholt. Studentinnen und Studenten fordern an den Hochschulen mehr Beschäftigung mit dem Umbauen und der Ressourcenschonung ein sowie partizipative Arbeitsformen.
Neubau wird künftig die Ausnahme sein und das Modell des Stararchitekten ist überholt. Studentinnen und Studenten fordern an den Hochschulen mehr Beschäftigung mit dem Umbauen und der Ressourcenschonung ein sowie partizipative Arbeitsformen.
Jörg Biesler diskutiert darüber mit seinen Gästen:
Sarah Bolk, Stadtgestalterin der Stadt Meerbusch
Fabian P. Dahinten, Mitbegründer und Präsident der Nachwuchsorganisation nexture+ und Partner bei Lengfeld und Wilisch Architekten in Darmstadt
Bianca Klein, Leiterin Geschäftsstelle Baukultur Rheinland-Pfalz
Peter Köddermann, Geschäftsführer Programm Baukultur NRW
Tobias Nöfer, Nöfer Architekten Berlin
Was haben Wohnformen mit Demokratie zu tun?
Interview mit Christoph Mäckler im bpd Magazin Nr. 20 | Juni 2024
SIE HABEN DAS DEUTSCHE INSTITUT FÜR STADTBAUKUNST GEGRÜNDET, DAS SICH FÜR EINE NACHHALTIGERE UND SCHÖNERE STADTPLANUNG EINSETZT. WARUM?
Schauen Sie sich doch einfach einmal um. Viele Wohngebiete sind aseptisch, um nicht zu sagen hässlich. Häufig liegt es an den Investoren, die sparen möchten und die nicht verstehen, dass sie auch mit Qualität Geld verdienen können. Häufig liegt es aber auch an der mangelhaften Ausbildung von Stadtplanern. An vielen Hochschulen wird ihnen hauptsächlich Verwaltungshandwerk wie Prozesssteuerung beigebracht. Sie lernen, wie man Beteiligungsprozesse durchführt, aber nicht, wie Wohnungsbau funktioniert und wie man städtische Räume so planen kann, dass sich die Menschen darin wohlfühlen. Seit 1968 galt Gestaltung in vielen Städten und Hochschulen als des Teufels und als Etwas für die oberen Zehntausend.
Eigentlich haben wir bereits seit dem Ersten Weltkrieg aufgehört, städtische Straßen und Plätze zu bauen, sondern nur Siedlungsbau betrieben. Die Baunutzungsverordnung, die in den 1960er-Jahren in Gang gesetzt wurde, hat dafür gesorgt, dass Sie nicht mehr dicht bauen können. Das ist nicht nur ökologischer Unsinn, weil sie mehr Flächen versiegeln müssen. Ohne Dichte gibt es keine Restaurants oder Läden, weil es keine Menschen gibt, die dort kaufen oder essen könnten. Wir brauchen Städte, in denen nicht nur gewohnt, sondern in denen auch gearbeitet und gelebt wird. Es ist einfach ein Erfahrungswert, dass wir in dichten Städten wie in Paris lieber leben.
IHR THEMA IST STADTRAUM UND DEMOKRATIE. WAS HABEN DIE BEIDEN DINGE MITEINANDER ZU TUN?
Sie können mit Städtebau natürlich keine Demokratie schaffen. Es gibt aber Wohnformen, die demokratiefördernd sind. In Städten mit Gebäuden aus dem 19., 18. oder auch des 17. Jahrhunderts finden Sie beispielsweise Hofbebauungen. Die Mieter haben damit zusätzlich zur Wohnung eine Freifläche, die sie sich mit der Hausgemeinschaft teilen. Sie müssen sich also mit ihren Nachbarn einigen, wie sie den geschützten Hof- oder Gartenraum nutzen. Das ist nichts anderes als ein demokratisches Handeln. Im Wohnungsbau gibt es kaum noch solche geschützten Bereiche. Im Institut arbeiten wir deshalb auch an Haustypen, mit denen man eine solche Gartenhofbebauung umsetzen kann.
DIE UMSETZUNG DÜRFTE ABER TEUER SEIN UND NOCH MEHR FLÄCHEN FRESSEN
Ganz im Gegenteil. Wir forschen im Moment an unterschiedlichen Bautypen wie Eckhäusern und Flügelhäusern. Früher hatten viele Häuser nach hinten hinaus Flügel, d.h. sie waren in die Tiefe des Grundstücks hineingebaut und hatten daher wenig Straßenfläche. Wir haben für ein Wohngebiet in Hannover diese Bautypen auf der Grundlage des geförderten Wohnungsbaus versuchsweise darübergelegt und waren selbst überrascht. Wir hatten fast 50 Prozent weniger Erschließungsflächen. Das bedeutet, dass Sie weniger Flächen versiegeln müssen und niedrigere Erschließungskosten bei wesentlich höherer Wohnfläche erhalten. Gleichzeitig haben Sie die Hofräume und große unbebaute Flächen, die Sie z. B. in Parks umwandeln können.
https://www.bpd-immobilienentwicklung.de/aktuelles/bpd-magazin/
Interview Deutschlandfunk mit Christoph Mäckler
Bei dem Begriff Innenstadt gehe man meist vom Shopping aus, sagt Christoph Mäckler, Direktor des DIS, im Interview mit Deutschlandfunk, aber diese Monofunktionalität sei nicht richtig.
Bei dem Begriff Innenstadt gehe man meist vom Shopping aus, sagt Christoph Mäckler, Direktor des DIS, im Interview mit Deutschlandfunk, aber diese Monofunktionalität sei nicht richtig.
Man müsse dahin zurück, wieder normale Stadtstraßen zu bauen, in denen gewohnt und gearbeitet werde. Dazu brauche es Kleinteiligkeit. Also keine riesigen Kaufhäuser, sondern kleinere Läden. Dies wiederum setze einen vernünftigen Straßenverkehr voraus, zu dem Fahrrad und öffentlicher Nahverkehr, aber auch das Auto gehörten.
Interview SWR KULTUR mit Prof. Georg Ebbing
Prof. Georg Ebbing ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des DIS. In einem Interwiev mit SWR Kultur spricht er zum Thema Ecken in der Architektur.
Prof. Georg Ebbing ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des DIS. In einem Interwiev mit SWR Kultur spricht er zum Thema Ecken in der Architektur.
Die Ecke verbindet bei Häusern das Innere mit dem Äußeren. Vor allem Eckzimmer und Eckhäuser spielen im urbanen Kontext eine wesentliche Rolle. Sie prägen in besonderer Weise das Erscheinungsbild und den Charakter einer Stadt.
Biotop Fußgängerzone – Abschaffen oder Reanimieren?
Zum 70. Jubiläum der Fußgängerzonen in Deutschland hat der Deutschlandfunk Christoph Mäckler gefragt: Abschaffen oder Reanimieren? Seine Antwort ist eindeutig!
Zum 70. Jubiläum der Fußgängerzonen in Deutschland hat der Deutschlandfunk Christoph Mäckler gefragt: Abschaffen oder Reanimieren? Seine Antwort ist eindeutig!
Stadtraum und Demokratie
Kann Stadtbaukunst Demokratie gestalten? Nein, aber sie kann den sozialen Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft fördern, indem sie die stadträumlichen Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben schafft.
Kann Stadtbaukunst Demokratie gestalten? Nein, aber sie kann den sozialen Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft fördern, indem sie die stadträumlichen Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben schafft.
In der alten, europäischen Stadt finden sich diese Voraussetzungen. In der neuen Stadt nicht. Deshalb benötigt sie einen „Quartiersmanager“. In den alten Quartieren der europäischen Stadt benötigt es keine „Quartiersmanager“ zur sozialen Stabilisierung.
Warum nicht? Weil es in der alten, europäischen Stadt grundsätzlich stadträumliche Voraussetzungen gibt, die ein soziales Miteinander befördern. Der neuen Stadt fehlen diese Voraussetzungen.
DER PRIVATE STADTRAUM
Hof und Garten versus „Wohnumfeld“
So ist die europäische Stadt im Gegensatz zu unseren Neubauquartieren über eine Blockstruktur prinzipiell in öffentliche und private Räume getrennt. Der heutige Städtebau kennt diese Unterscheidung nicht. Außer in der Planung von Einfamilienhausbebauungen und Gewerbegebieten finden sich in Deutschlands Städtebau keine privaten Stadträume, Höfe oder Gärten mehr. Damit fehlen der Stadt die Nischen, in denen sich soziales Leben entwickeln kann.
Die Trennung der Stadt in öffentliche und private Räume stellt schon deshalb eine grundlegende Qualität im Städtebau dar, weil den Bewohnern damit zusätzlich zu ihren Wohnungen Freiflächen, Gärten und Höfe, auf dem Grundstück ihrer Mietshäuser zur Verfügung gestellt werden können, um die sie sich in Eigenverantwortung und im Austausch miteinander kümmern. Diese Verantwortung löst innerhalb einer Hausgemeinschaft eine hohe Identifikation mit dem eigenen „zu Hause“ aus. Sie entwickelt aber auch gegenseitiges Vertrauen. In einer Zeit, in der beide Elternteile beruflich engagiert sind, ist der hauseigene Hof- oder Gartenraum für das Aufstellen einer Sandkiste beispielsweise bestens geeignet, weil er im geschlossenen Hof der Aufsicht der Hausgemeinschaft unterliegt. Die Kinder sind auch ohne das Beisein ihrer Eltern beaufsichtigt.
Schon jedes Reihenhaus hat diese Sandkiste im Garten stehen. Warum, so fragt man sich, gewährt der heutige Städtebau dem Besitzer des Reihenhauses die private Freifläche, dem Bewohner des Mietshauses aber nicht? 50 Prozent der Einwohner leben in Deutschland zur Miete! Trotzdem hat das heutige Mietshaus keine privaten Freiflächen, keine Höfe und Gärten, in denen Kinder ungestört spielen können. Vielmehr ist es von öffentlichen Freiflächen, dem sogenannten Wohnumfeld, umgeben.
Der Verantwortungsverlust, der sich für die Bewohner damit auftut, führt zum Verlust des sozialen Zusammenhalts, zur Anonymität und zum hilflosen Versuch, diesem Verlust mit staatlich geförderten Quartiersmanagern entgegenzuwirken. Die eigenverantwortliche Organisation von Hof und Garten dagegen, die nur durch die Trennung in öffentliche und private Stadträume ermöglicht wird, stärkt das soziale Miteinander und fördert demokratisches Verhalten in der täglichen Auseinandersetzungder Hausgemeinschaft.
DER ÖFFENTLICHE STADTRAUM
Straße und Platz versus „Erschließungsfläche“
Eine jede Stadt funktioniert über ihre Straßen, mit denen die privaten Grundstücke erschlossen werden, aber erst mit der Einfassung durch die Straßenfassaden wird die Straße auch zum Straßenraum. Dieser Straßenraum muss, wie der Hofraum, als Wohnraum der Stadt verstanden werden. Straßen- und Platzräume bilden den sichtbaren Charakter einer Stadt und werden für jede Art von öffentlichem Zusammenkommen, Märkten, Festen und Demonstrationen genutzt. Es sind Räume, deren Schönheit von der Geschlossenheit der Straßen- und Platzfassaden ihrer Mietshäuser bestimmt werden.
Straßenräume und individuelle Fassaden
Die Mietshäuser der europäischen Stadt haben Standardgrundrisse. Aber jedes dieser Häuser hat im Unterschied zu heute individuelle Straßenfassaden. Jeder Hauseingang, jedes Haus hat seine eigene Fassade. Dies gibt jeder Straße ihren eigenen Charakter und führt für die Mieter zur Identifikation mit „ihrem“ Haus und „ihrem“ Straßenraum.
Straßenräume und soziale Vielfalt
Die europäische Stadt hat Straßenräume mit Mietshäusern, die verschiedene Wohnungsgrößen haben und damit unterschiedlichen Einkommensgruppen Wohnraum bieten. Das fördert die soziale Vielfalt einer demokratischen Gesellschaft auf nur einer einzigen Parzelle und steht ganz im Gegensatz zu den anonymen Großbauten des geförderten Wohnungsbaus unserer Zeit.
Straßenräume und funktionale Mischung
Die europäische Stadt hat Gewerbehofhäuser, in denen auf mehreren Geschossen unterschiedliche Betriebe, vom Startup bis zum Malerbetrieb, untergebracht sind. Dieser Haustyp stellt einen der beliebtesten Arbeitsplätze dar, weil er sich inmitten der Stadt befindet. Die Verdrängung der Arbeitsplätze in Gewerbegebiete lässt das Leben in der Stadt absterben.
Straßenräume und hohe Dichte
Eine der grundlegenden Voraussetzungen für das Funktionieren eines lebendigen Stadtviertels ist die Einwohnerdichte. Die dicht gebaute Stadt hat kurze Wege und führt zu Sozialkontakten, die in der flächenfressenden Weite unserer Neubaugebiete nicht vorhanden sind. Einwohnerdichte bedeutet nicht hohe Häuser entlang dunkler Straßen, sondern entsteht, wie die Stadtviertel des 19. Jh. zeigen, durch das Flügelhaus, das sich mit seinen Höfen in die Tiefe des Grundstücks entwickelt.
Straßenräume und Verkehrs-Trasse
Die „autogerechte Stadt“ der 70er-Jahre hat mit ihren weißen Fahrspurmarkierungen und dreispurigem Ausbau die Stadt-Straße zur Verkehrs-Trasse für den Automobilverkehr degradiert. Hilflos versucht man dies mit roten Farbmarkierungen zu ändern. Städtebaulich aber bedarf es eines Rückbaus zur deutlich langsameren schönen Stadtstraße mit Gegenverkehr. Die Stadt Kopenhagen hat dies umgesetzt. Unser Farbfunktionalismus zerstört den lebenswerten öffentlichen Wohnraum der Stadt.
Straßenräume und öffentliche Gebäude
Grundsätzlich und leider in Vergessenheit geraten, wird mit der Präsenz öffentlicher Gebäude im Stadtraum die Identifikation mit der Stadt gefördert. So werden in Frankfurt am Main alle Straßenräume, die auf den Hauptbahnhof zuführen, eindrucksvoll von seinen Eckrisaliten und dem Hauptportal städtebaulich abgeschlossen. In der entgegengesetzten Richtung vom Bahnhof aus, erblickt der ankommende Reisende durch die Münchener Straße den Rathausturm Frankfurts. Als Symbol unserer parlamentarischen Demokratie darf das Rathaus fast 80 Jahre nach Kriegsende, in einer Zeit, in der die Demokratie weltweit in Frage gestellt wird, die Stadt Frankfurt am Main nicht als Ruine mit Notdach repräsentieren.
„Warum deutsche Städte so hässlich sind”
Viele Menschen finden unsere Städte in ihrer heutigen Form unattraktiv. Im Video „Warum deutsche Städte so hässlich sind” geht der YouTube-Kanal Simplicissimus der Frage nach, was die Gründe dafür sein können. Neben der Historie des Städtebaus geht er u. a. auf städtische Angsträume und die Flut der Baunormen ein.
Als Experten kommen die Architekturhistorikerin Kaija Voss und Christoph Mäckler zu Wort.
Viele Menschen finden unsere Städte in ihrer heutigen Form unattraktiv. Im Video „Warum deutsche Städte so hässlich sind” geht der YouTube-Kanal Simplicissimus der Frage nach, was die Gründe dafür sein können. Neben der Historie des Städtebaus geht er u. a. auf städtische Angsträume und die Flut der Baunormen ein.
Als Experten kommen die Architekturhistorikerin Kaija Voss und Christoph Mäckler zu Wort.
Freiheit braucht Demokratie -Demokratie braucht Demokraten
Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2023 riefen mehr als 100 Persönlichkeiten aus der demokratischen Zivilgesellschaft öffentlich dazu auf, für unsere Demokratie einzutreten.
Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2023 riefen mehr als 100 Persönlichkeiten aus der demokratischen Zivilgesellschaft öffentlich dazu auf, für unsere Demokratie einzutreten. Die Würde des Menschen ist unantastbar – Wir stehen für Demokratie und Rechtsstaat, lautete der Titel des Aufrufs, den der Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst, Prof. Christoph Mäckler, und der Vorsitzende des DIS-Kuratoriums, Mike Groschek, NRW Staatsminister a.D., unterzeichnet haben. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Aufrufs treten mit ihrem Namen für unsere Demokratie ein und haben öffentlich ein Zeichen gesetzt gegen die Feinde der Verfassung, die unsere Demokratie bekämpfen.
Auf die Frage, ob Stadtbaukunst Demokratie gestalten kann, antwortet Christoph Mäckler: „Nein, aber sie kann den sozialen Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft fördern, indem sie die stadträumlichen Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben schafft. Der öffentliche Raum ist der Sozialraum unserer Demokratie.“ Deshalb setzt sich das DIS für einen nachhaltigen, dauerhaften und schönen Städtebau in Deutschland ein.
Langsamer auf dem Weg zu einer schönen Stadt
Eine attraktive Kommune braucht nach Ansicht des Architekten Christoph Mäckler gut gestaltete Straßen, auf denen sich auch Fußgänger sicher bewegen können. Entscheidend dafür sei ein Tempolimit, meint er.
Eine attraktive Kommune braucht nach Ansicht des Architekten Christoph Mäckler gut gestaltete Straßen, auf denen sich auch Fußgänger sicher bewegen können. Entscheidend dafür sei ein Tempolimit, meint er.
FAZ Artikel, 23. August 2023
Christoph Mäckler steht am Eschenheimer Turm und schaut auf den Verkehrsknoten: Fünf Fahrspuren plus Radweg gibt es dort in Fahrtrichtung Osten, aus Norden kommen weitere Fahrbahnen hinzu. Der Architekt fasst sich ein Herz, überquert in einem günstigen Moment gelassenen Schrittes die Asphaltbahn in Richtung der Verkehrsinsel, auf der sich der seit Jahren trockengelegte Göpfertbrunnen befindet. Die Verkehrsplaner haben es gar nicht vorgesehen, die Straße an dieser Stelle zu überqueren. Fußgänger sollen sich woanders bewegen.
Für Mäckler sind die Verkehrsflächen am Eschenheimer Turm – dem einzigen erhaltenen mittelalterlichen Stadttor Frankfurts – ein Beispiel dafür, wie Stadtstraßen nicht gestaltet sein sollen. Zu sehr gäben heute das Straßenverkehrsrecht und der Wunsch nach leistungsfähigen Schneisen die Ziele vor. „Unsere Straßen kommen aus der Zeit der autogerechten Stadt“, meint der Architekt. Kürzlich hat das von Mäckler gegründete und in Frankfurt ansässige Institut für Stadtbaukunst in Düsseldorf eine ganze Tagung dem Thema gewidmet. Am Ende forderten die Teilnehmer, unter ihnen viele kommunale Praktiker, nichts weniger als die Novellierung des Straßenverkehrsrechts. Denn der rechtliche Rahmen sei „in hohem Maße gestaltrelevant“, heißt es in der Resolution.
Die Kommunen müssten das Recht bekommen, die zulässigen Geschwindigkeiten auf den Stadtstraßen selbst festzulegen. „Nur dadurch können die Konflikte unter den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden minimiert, Sicherheit und Gesundheit erhöht und die Qualität der Stadtstraßen als Lebensraum für die Stadtgesellschaft gewährleistet werden.“ Die gewonnenen Spielräume würden „dringend benötigt für die erforderliche Anpassung unserer Straßenräume an die Anforderungen von Verkehrswende und Klimawandel“. Außerdem müssten Regeln zum Parken und zur Höhe von Bußgeldern überarbeitet werden, heißt es in der Resolution, die auch von der Bundesstiftung Baukultur, Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses des Deutschen Städtetags und der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen mitgetragen wird.
Der Forderungskatalog liest sich stellenweise so, als stamme er aus einem Wahlprogramm der Grünen. Doch Mäckler ist nicht mit allen Ideen einverstanden, die derzeit unter dem Schlagwort „Verkehrswende“ in die tat umgesetzt werden. Von Straßensperrungen hält er nichts. seit Jahren wirbt er dafür, selbst auf der Zeil wieder Autoverkehr zuzulassen. „Fußgängerzonen haben sich überlebt.“ ihm geht es darum, vor allem von den „Rennstrecken“ wegzukommen, wie er die großen Trassen nennt, die zum teil als mehrspurige Einbahnstraßen die Stadt durchziehen. seine Vision sind „normale Stadtstraßen“ mit Zweirichtungsverkehr, auf denen Autos langsam unterwegs sind und sich Fußgänger und Radfahrer sicher bewegen können. „Der Verkehr wird langsamer, aber man kann überall fahren.“ Dann sei es auch nicht mehr nötig, Radwege rot einzufärben, wie es seit einigen Jahren in Frankfurt üblich ist. „Das kann keine Dauerlösung sein.“
Bei seinem Vortrag auf der Düsseldorfer Tagung zeigte Mäckler, wie gut gestaltete Straßen aussehen könnten: Ein Baumdach am Rand hält der Architekt angesichts der zunehmenden Sommerhitze für dringend erforderlich. „Das finden sie im Mittelmeerraum überall“, sagt er. Dort seien auch vergleichsweise enge Straßen üblich, auf denen die angrenzenden Häuser Schatten werfen. Kioske und Treffpunkte seien für ein vielfältiges Straßenbild nötig. „Das A und O ist die Nutzungsmischung. Sonst sind die Straßen abends tot.“
Attraktiv wird der Straßenraum nach Überzeugung Mäcklers erst durch gut gestaltete Häuser auf beiden Seiten. Sie müssten so geplant sein, dass es eine klar definierte Straßenfront und einen privaten Raum auf der Rückseite gebe. Freistehende Punkthäuser, wie man sie aus Neubaugebieten kennt, sind ihm ein Graus. Ebenso Siedlungen, die seit 1920 entstanden und zum Teil gar nicht mehr zur Straße hin orientiert sind. Das erschwere die Orientierung. „in der Nordweststadt verläuft man sich.“
Mehrere verschiedene Haustypen, die Stadtstraßen säumen können, haben Mäckler und seine Mitarbeiter für das „Handbuch der Stadtbaukunst“ zusammengetragen, das als eine Art Werkzeugkasten für Stadtplaner gedacht ist. Selbst wenn sich in einer Straße diese Haustypen wiederholten, müsse keine Monotonie entstehen, wie sie kennzeichnend sei für große Wohnblocks mit langen Fronten, an denen jeder Eingang gleich aussehe. Mäckler verweist auf die Stadterweiterungen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals basierten die einzelnen Häuser auf wenigen Grundtypen. Doch die Fassaden wurden unterschiedlich gestaltet, um für Abwechslung zu sorgen. Vorbild ist für ihn Paris. „Da würde gerne jeder wohnen.“
Über diese Themen diskutiert Mäckler mit Wohnungsbaugesellschaften. Mit der ABG Frankfurt Holding entwickelt er einen Haustypus, der auch in größeren Quartieren mit Sozialwohnungen funktioniert – und der auch einen gut gestalteten Straßenraum ermöglicht.
Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt No. 13 — Die Stadtstrasse
Zusammenfassender Beitrag zur Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt No. 13, die am 20./21. Juni 2022 zum Thema "Die Stadtsraße" in der Düsseldorfer Rheinterrasse stattfand. Sendetermin: 29. Juni 2023 Rhein-Main TV.
Hinweis auf den zusammenfassenden, einstündigen Beitrag zu unserer 13. Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, der am 29.06.2023 im Rhein-Main TV ausgestrahlt wurde.
Neuer Podcast mit Wolfgang Sonne
Hinweis auf das Gespräch zwischen Prof. Christian Heuchel und Prof. Wolfgang Sonne (TU Dortmund und Baukunstarchiv NRW) über gute Stadtentwicklung und die Grundprinzipien des heutigen Städtebaus im Rahmen der Diskussionsveranstaltung “Town Planning in Democratic Structures”
Der Veedelsbaumeister und seine Bedeutung für die Stadtentwicklung
Über dieses Thema diskutiert Prof. Christian Heuchel gemeinsam mit seinem Gast Prof. Wolfgang Sonne (TU Dortmund und Baukunstarchiv NRW). Nach welchen Regeln sollten heutzutage Städte gebaut werden? Welche Grundprinzipien guter Stadtentwicklung gibt es? Wieviel Demokratie machen Stadtentwicklung und Stadtplanung möglich?
Kein schöner Platz in dieser Stadt
Auch neu gestaltete Plätze rufen in Frankfurt oft heftige Kritik hervor. nach Ansicht des Architekten Christoph Mäckler sind sie misslungen, weil grundlegende Prinzipien nicht beachtet wurden. Mit seinem „Handbuch der Stadtbaukunst“ will er Anregungen geben für bessere öffentliche Räume.
FAZ Artikel, 20. April 2023
Auch neu gestaltete Plätze rufen in Frankfurt oft heftige Kritik hervor. nach Ansicht des Architekten Christoph Mäckler sind sie misslungen, weil grundlegende Prinzipien nicht beachtet wurden. Mit seinem „Handbuch der Stadtbaukunst“ will er Anregungen geben für bessere öffentliche Räume.
Peter Cachola Schmal ist ratlos. auf die Frage von F.a.Z.-Redakteur Matthias Alexander, wo in Frankfurt in den vergangenen 20 Jahren ein schöner Platz entstanden sei, weiß der Direktor des Deutschen Architekturmuseums keine Antwort. Den Berliner Architekten Martin Rein-Cano wundert das nicht: „es gibt in ganz Deutschland keinen Stadtraum in Neubauvierteln, der gestalterisch gelungen ist“, sagt er und fügt selbstkritisch hinzu: „Das haben wir nicht auf die Reihe bekommen.“
Der Satz fällt am Dienstagabend auf einer Veranstaltung, in der es eigentlich darum gehen soll, was eine gute gestal-tung des öffentlichen Raums ausmacht. Der Frankfurter Architekt Christoph Mäckler stellt das von ihm herausgegebe-ne „Handbuch der Stadtbaukunst“ vor. Das vierbändige Werk soll Planern zei-gen, wie Höfe, Straßen und Plätze so gestaltet werden können, dass man sich dort gerne aufhält. „Wir müssen die Struktur der europäischen Stadt verste-hen“, sagt Mäckler. Dafür hat er mit Stu-denten und Mitarbeitern viele aus seiner Sicht gelungene Beispiele aus zahlrei-chen deutschen Städten zusammengetragen. eines davon ist der kreisrunde Gärtnerplatz in München. Hier stimme nicht nur die angrenzende Bebauung („auch die Fassaden sind gerundet“), zu der unter anderem ein theater gehört, son-dern auch die gestaltung im Detail. „Hier steht jeder Baum und jede laterne an der richtigen Stelle.“
Dieses lob wird Elisabeth Merk gefreut haben. Die architektin, Stadtbaurätin in München, ist eigens nach Frank-furt gereist, um das Werk ihres Kollegen Mäckler zu würdigen. Sie betont, dass es im öffentlichen raum nicht nur um Gestaltungsfragen gehe. „gut gelungen ist ein Platz, zu dem alle Zugang haben. Das geht nicht mit Kulissenschieberei. Wichtig ist der menschliche Maßstab.“ als Kulisse oder rein stilorientierte Planung will Mäckler seine gestaltungsprin-zipien nicht missverstanden wissen. aber er sagt auch: „es muss möglich sein, sich einfach nur auf einen Platz zu setzen und dessen Schönheit zu genießen.“
Merk stellt diesem Satz die Forderung nach einer „Ästhetik des gebrauchs“ zur Seite. Wenn ein Platz nicht nur schön, sondern auch funktional sei, dann sei die Gestaltung auch sozial. Dazu trage eben-so eine öffentliche nutzung in den umlie-genden gebäuden bei. Mäckler stimmt zu und spricht sich dafür aus, Schulen nicht am Rand von Neubaugebieten zu bauen, sondern an einem zentralen Platz. gleichzeitig sei eine gewisse Dichte der Bebauung nötig, damit lebendigkeit entstehe. Merk warnt aber auch: „Gestaltung kann nicht andere gesellschaftliche Defizite kompensieren.“
Schmal weist auf den Strukturwandel der innenstädte hin. „Was wird aus unseren Städten, wenn wir dort nicht mehr einkaufen?“, fragt er. auf diese Entwicklung dürfe man nicht nur mit Gestaltung reagieren. „ein Platz kann noch so schön sein. Wenn die nutzung dahinter nicht stimmt, funktioniert er nicht.“
In Mäcklers Handbuch geht es um vie-le weitere gestaltungsprinzipien. Bei der Vorstellung greift er das thema Höfe heraus. Mit der Blockrandbebauung sei ende des 19. Jahrhunderts die trennung von privaten innenhöfen und öffentlichem raum vorbildlich gelungen, sagt er. „Die Hofform ist eine soziale errungenschaft, die man erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe.“ Doch werde sie heute nicht mehr geschätzt. Mäckler führt als Beispiel Neubauquartiere auf dem Riedberg an.
Dort seien einzelne Häuser nebeneinander wie „Brocken“ in die Landschaft gestellt worden. es entstehe weder ein qualitativ hochwertiger privater noch ein gut gestalteter öffentlicher Raum.
Dass dieser in den Städten zuneh-mend verwahrlost, beklagt Rein-Cano und fordert: „Wir müssen mehr Geld für die Pflege des öffentlichen raums aufwenden.“ Plätze müssten in die Zustän-digkeit der städtischen Kulturverwaltung überführt und „kultiviert werden wie ein theater oder eine Oper“. Mäckler meint dazu: „es kann nicht sein, dass wir es als reiche Gesellschaft nicht hinkriegen, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass die Menschen sich wohlfühlen.“
Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt No. 12 — Die Grüne Stadt
Zusammenfassender Beitrag zur Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt No. 12, die am 14./15. Juni 2022 zum Thema "Die Grüne Stadt" in der Düsseldorfer Rheinterrasse stattfand. Sendetermin: 07. Juli 2022 Rhein-Main TV.
Hinweis auf den zusammenfassenden, einstündigen Beitrag zu unserer 12. Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, der am 08.07.2022 im Rhein-Main TV ausgestrahlt wurde.
Ein Bundesbauministerium muss her
Wenn der Lockdown etwas off enbart hat, dann, dass die gebaute Hässlichkeit, Tristesse und Leblosigkeit unserer Städte an vielen Orten unerträglich geworden ist.
FAZ Artikel, 27. Oktober 2021
Wenn der Lockdown etwas off enbart hat, dann, dass die gebaute Hässlichkeit, Tristesse und Leblosigkeit unserer Städte an vielen Orten unerträglich geworden ist. Trotzdem diskutiert man nach der Bundestagswahl nicht, wer das Ressort des Bundesbauministeriums übernimmt, das fast 25 Jahre ein Anhängsel des Verkehrsministeriums, des Umweltministeriums und zuletzt des Innenministeriums ist. Dabei sind die Fragen des Städtebaus für den sozialen Zusammenhalt unserer demokratischen Gesellschaft von grundlegender Wichtigkeit. Wer einen „Aufbruch“ will, wie dies in Berlin von der Politik gefordert wird, der muss nicht nur die Finanzen und die Umwelt, sondern unsere reale Lebenswelt, die Welt unserer Straßen und Plätze politisch in Angriff nehmen.
Denn im heutigen Städtebau gibt es kaum einen neuen öff entlichen Stadtraum, in dem sich der Bewohner wohlfühlt. Er lebt lieber in den Häusern alter Stadtviertel der europäischen Stadt als im Neubauviertel unserer Zeit.
Ein Haus von 1890 ist mehr wert als ein Haus von 1990. Weil letzteres auf der Grundlage bundesdeutscher Städtebaugesetze der 1960er Jahre errichtet ist, die die Stadt in funktionale und „aufgelockerte“ Stadtbereiche aufteilen: hier wohnen, dort arbeiten, hat das Haus von 1990 weniger Lebensqualität als das Haus von 1890 (achtzehnhundertneunzig!). Schon der Mietpreis zeigt, dass unsere Gesellschaft es vorzieht, in Altbauvierteln zu wohnen, als in irgendeinem Neubauquartier. Das ist für die politisch Verantwortlichen unserer Städte bitter.
Es steht ihnen aber auch seit mehr als zwei Jahrzehnten kein Bundesbauministerium zur Seite, das sich um zeitgemäße Gesetzesgrundlagen des Städtebaus kümmern würde, damit angemessene, schöne, sozial ausgewogene, dichte und lebendige Stadträume errichtet werden können. (FAZ vom 1.9. 2016) Die Liste der Anforderungen an neue Gesetze, die ein Bundesbauministerium zu bearbeiten hätte, ist lang. Und sie ist überfällig. Sie einem Innenministerium unterzuordnen, ist geradezu abenteuerlich. Die Brisanz der gebauten Welt für ein demokratisches Zusammenleben aber scheint den politisch Verantwortlichen in Berlin nicht präsent zu sein. Oder wie ist es zu erklären, dass die Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst, die von über 100 Baubürgermeistern, Planungsdezernenten und Planungsamtsleitern deutscher Städte unterschrieben wurde und die Änderung von Bundesbaugesetzen fordert (FAZ vom 7.5. 2019), in der Bundespolitik weitgehend ignoriert wird? In der Berliner Bundespolitik fühlt sich für den Städtebau keiner verantwortlich. Man spricht Einzelelemente der Stadtplanung an, diskutiert den Wohnungsmangel und die Höhe der Mieten, spricht im Rahmen des Klimawandels von grüner und blauer Stadt und seit Neuestem von „Schwammstadt“, vergisst aber dabei die existenziell wichtige Sozialfunktion des Städtebaus, die mit der Gestalt der Stadträume, der Plätze, Straßen und Höfe einhergeht.
Den Ministerien, die erheblichen Einfluss auf die Planung der Stadt ausüben, steht seit Jahrzehnten kein Bauministerium mehr gegenüber, das mit zeitgemäßen Gesetzesinitiativen die Entwicklung lebenswerter Stadträume ermöglichen würde. Dieses politische Defi zit bildet sich in direkter Weise in unserer gebauten Umwelt ab:
– Dass Straßenbauten mit ihren oft überdimensionierten Fahrbahnen Wohngebiete durchschneiden, dass sie nur der Funktion des Individualverkehrs genügen, ist mit einem Verkehrsministerium zu erklären, das städtebauliche Fragen weitgehend ignoriert. – Dass Wohngebiete ohne stadträumliche Qualitäten existieren, ist ebenfalls der Trennung der Bundesministerien in Verkehr und Planung zuzuschreiben. – Dass keine Gewerbehöfe errichtet werden, in denen sich, wie in der funktionsgemischten europäischen Stadt üblich, Kleingewerbe oder junge Startups ansiedeln können, verhindern u.a. Gesetze zum Lärmschutz, die vom Umweltministerium aufgestellt wurden. – Dass mit Wärmedämmsystemen Sondermüll produziert wird, anstatt auf eine Bauweise mit nachhaltigen Materialien zu setzen, ist auch auf den fehlenden Dialog zwischen dem Umweltministerium und einem Bauministerium zurückzuführen. – Dass im Eindruck des Klimawandels in neuen Wohngebieten keine städtischen Parks mit großem Baumbewuchs, keine Alleen oder Boulevards angelegt werden, ist ebenfalls der Trennung der Bundesministerien in Umwelt und Planung zuzuschreiben. – Dass es keine privaten Wohnhöfe gibt, ist u.a. den Bundesgesetzen zur Bebauungsdichte und den weltfremden Richtlinien zur Besonnung neu zu errichtender Wohnungen zuzuschreiben, die der Entstehung dieser Höfe entgegenwirken.
Unsere Baugesetze basieren auf der Ideologie der aufgelockerten Stadt der 1960er Jahre. Wenn es einen politischen Neuanfang in Deutschland geben soll, muss eine Änderung dieser Baugesetze erfolgen. Ohne ein Ministerium, das sich diesen Themen intensiv widmet, wird es keinen Aufbruch geben!
Prof. Christoph Mäckler, Prof. Dr. Wolfgang Sonne Deutsches Institut für Stadtbaukunst
Von Haus aus missglückt
Bauherren und Architekten im Würgegriff des Bebauungsplans: Warum nur ist uns die Fähigkeit abhandengekommen, schöne und bewohnbare Städte zu bauen? Ein Denkanstoß.
FAZ Artikel, 1. September 2016
Bauherren und Architekten im Würgegriff des Bebauungsplans: Warum nur ist uns die Fähigkeit abhandengekommen, schöne und bewohnbare Städte zu bauen? Ein Denkanstoß.
Warum eigentlich sind unsere alten Städte in Europa schöner als alles, was Planer und Architekten je in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg an Neuem entwickelt haben? Ist das normal? Sind Städte, wie der eine oder andere Kritiker im Brustton der Überzeugung öffentlich vertritt, unplanbar? Oder beruht der desolate Zustand der neuen Stadtviertel mit ihren traurig-tristen Straßen, denen jede Anmutung und Aufenthaltsqualität fehlt, einfach nur auf einem fatalen Unwissen der Fachleute, Straßen und Plätze als städtische Aufenthaltsräume zu planen?
Offenbar haben wir uns daran gewöhnt, dass wir, wenn von Florenz als schöner Stadt die Rede ist, nicht die Neubauviertel der vergangenen fünfzig Jahre, sondern ausschließlich vom Zentrum der Stadt mit der Piazza della Signoria sprechen. Wer Barcelona als die schönste Stadt am Meer benennt, meint die alte Rasterstadt mit dem prächtigen Boulevard, den Ramblas und nicht die Erweiterung der Stadt, wie sie von Planern für Olympia 1992 mit einem Etat von 5,5 Milliarden Euro angelegt wurde.
Und wenn wir von Paris schwärmen, haben wir das Paris Haussmanns vor Augen und nicht das von 1963 an entstandene Viertel La Défense hinter dem Arc de Triomphe oder gar die Banlieues, jene Neubauviertel außerhalb des Stadtzentrums, die zum Inbegriff sozialen Abstiegs mutierten. Und natürlich haben die Demonstrationen gegen die Anschläge auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ auch nicht in diesen neuen Vierteln, sondern auf dem Place de la République stattgefunden.
Und wenn wir durch die von Planern angepriesenen neuen Stadtviertel hinter den Bahnhöfen von Stuttgart, Zürich, oder Frankfurt gehen, die ihre Urbanität und Zukunftsfähigkeit glauben schon mit ihrem Namen „Europaviertel“ nachweisen zu können, fröstelt es uns angesichts der abstoßenden Kälte und Langeweile, die uns in den ungefassten Stadträumen entgegenschlägt. Genaugenommen sind es auch keine Stadträume, sondern Resträume, die zwischen den von Architekten geplanten und neuerrichteten Häusern erhalten bleiben, und von Landschaftsplanern mit gepflasterten Wegen, Kinderspielgeräten, Bänken, Büschen und Bäumen aufgefüllt werden, damit sie gegenüber dem Bürger in ihrer räumlichen Belanglosigkeit noch irgendwie zu rechtfertigen sind. Diese Europaviertel reichen qualitativ nicht im mindesten an die vormodernen, mehr als hundert Jahre alten Stadtzentren heran.
Ist das normal? Müssen Neubauviertel aus neben- und hintereinandergestellten Behausungen ohne jeden räumlichen Bezug zueinander, ohne einen von Architekten entworfenen öffentlichen Stadtraum entstehen? Oder sind wir einfach nur Ewiggestrige, die wir es wagen, das Nichtvorhandensein des öffentlichen Raumes in städtebaulicher Qualität in unseren Neubauvierteln anzumahnen? Der derzeit landauf, landab zu beobachtende Wiederaufbau von alten Häusern und Quartieren jedenfalls scheint eigentlich nur der Hilfeschrei einer Gesellschaft zu sein, die von Planern und Architekten andere Qualitäten erwartet als das, was wir ihr in den letzten Jahrzehnten angeboten haben. Während die hohe Nutzungsmischung und die Dichte der Stadt, wie wir sie in den Vierteln des neunzehnten Jahrhunderts finden, in der Fachwelt mittlerweile eine weitgehend anerkannte Grundregel für die Planung eines neuen Quartiers darstellen, findet der architektonische Teil der Planung, der Entwurf des öffentlichen Raumes, des Straßen- und Platzraumes in Planer- und Architektenkreisen noch immer keine Anerkennung oder ist zumindest umstritten.
Dabei ist der öffentliche Raum der Stadt schlechthin der Gemeinschaftsbesitz unserer Gesellschaft. Der öffentliche Raum ist eine der größten Errungenschaften der alten europäischen Stadt. Hier traf man sich, um Ideen, Meinungen und Informationen auszutauschen. Vor allem aber kann dieser öffentliche Raum, im Gegensatz zu den bewachten sogenannten Gated Communities, von jedem Stadtbürger als Aufenthaltsraum genutzt werden, unabhängig von Herkunft, Position und sozialem Status.
Anders als der private Wohnraum des Hauses aber, in dem wir die Wandfarbe, den Teppich, das Parkett und den Sessel sorgfältig aussuchen, um uns wohl zu fühlen, bleibt die Gestalt des Straßen- und Platzraumes in unseren Stadtplanungsämtern ungeplant. Sie wird der Willkür und dem Unwissen einer privatwirtschaftlich orientierten Bauherrenschaft überlassen, die ihrerseits aber an der Schönheit des Quartiers interessiert ist, um damit eine bessere Vermarktung der jeweiligen Immobilie herbeiführen zu können. Denn der öffentliche Raum ist – mit einem Wort des Architekten und Kunsthistorikers Cornelius Gurlitt von 1920 – als erweiterter Wohnraum zu sehen.
Fakt ist, dass die Moderne europaweit nicht einen einzigen Platzraum hervorgebracht hat, der in seiner stadträumlichen Qualität mit dem Place des Vosges, der Piazza Navona oder auch nur mit dem unter dem damaligen Oberbürgermeister Walter Wallmann schon 1983 wiedererrichteten Rathausplatz der Stadt Frankfurt, dem Römerberg mit seinen giebelständigen Fachwerkhäusern, vergleichbar wäre. Noch im neunzehnten Jahrhundert aber finden sich diese stadträumlichen Qualitäten im Städtebau. Namen von Städtebauern wie Josef Stübben in Köln, Theodor Fischer in München oder Fritz Schumacher in Hamburg stehen beispielhaft für gelungene Stadträume, in denen sich die Bewohner noch wohl fühlen.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Städtebau in Deutschland ausschließlich gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen zu dienen hat, und uns gleichzeitig vergegenwärtigen, dass die auf dem Immobilienmarkt begehrtesten Stadtgebiete nicht etwa unsere heutigen Neubauviertel sind, sondern vor mehr als hundert Jahren realisierte Stadtentwürfe, wird deutlich, dass der öffentliche Raum eine architektonisch-städtebauliche Dimension hat, die es in unseren Stadtplanungsämtern wieder aktiv zu bearbeiten gilt.
Die Immobilienpreise zeigen, welchen Mehrwert ein altes Stadtquartier gegenüber einem Neubaugebiet hat. Ein Mietshaus aus dem Jahre 1886 stellt in einer Stadt wie Köln, Frankfurt, München oder Berlin einen weit wertvolleren Besitz dar, als ein vergleichbares Haus des Jahrgangs 1986. Das liegt aber nicht an der wiedererwachten Vorliebe unserer Gesellschaft für die Fassadenstuckaturen des neunzehnten Jahrhunderts, sondern ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass dieses Haus in einem Stadtquartier mit architektonisch gefassten öffentlichen Räumen, an Straßen und Plätzen dieser Zeit steht. Die Qualität alter Stadträume ist nicht irgendwie gewachsen, sondern dem städtebaulichen Entwurf der damaligen Zeit geschuldet.
Und natürlich findet die sogenannte Gentrifizierung nicht in Neubauvierteln oder in den Siedlungsgebieten der achtziger und neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern in erster Linie in den alten Stadtquartieren des neunzehnten Jahrhunderts statt. Der Immobilienmarkt macht uns also deutlich, dass die beliebtesten Stadtquartiere aus der Zeit der Erfindung des Automobils stammen. Würden wir heute aber mit einem Automobil dieser Zeit von München nach Hamburg fahren? Weder funktional noch ästhetisch entspricht es unseren heutigen Ansprüchen. Anders verhält es sich mit der Schönheit des städtischen Raumes dieser Zeit, die wir nicht als museal, sondern als zeitgemäße Wohnumgebung von höchster Qualität empfinden.
Wenn wir Architekten und Planer uns selbst in alten Stadtquartieren wohler fühlen als in den von uns konzipierten Neubauvierteln, warum versuchen wir diese stadträumlichen Qualitäten nicht in unsere Zeit zu transferieren? Warum lösen wir die Gentrifizierung statt mit politisch verordnetem Mietpreisstopp nicht mit der Errichtung von neuen Stadtquartieren der gleichen Qualität?
Heute stehen am Beginn einer Quartiersplanung technische Planungen. Man beginnt mit der Verkehrstechnik, der Trassenbreite von Straßen, ihren Abbiegespuren und weißen Verkehrsmarkierungen, statt den architektonisch stadträumlichen Charakter der Straße an den Anfang des Entwurfes eines Stadtquartiers zu stellen. Man beginnt mit theoretischen Planungen von städtischer Dichte statt mit dem konkreten Entwurf von städtischem Raum. Man stellt Häuser in mathematischen Verhältniszahlen von Gebäude- zu Grundstücksgröße zusammen, ohne Straßen und Plätze mit räumlich erlebbaren Proportionen als öffentliche Stadträume zu entwerfen.
Der zeitgenössische Bebauungsplan zeigt mit seinem Zahlenwerk dem Betrachter nicht, wie die Häuser zueinander stehen, um miteinander einen gemeinsamen Raum, einen Straßen- oder Platzraum zu bilden. Er ist kein Instrument, mit dem der öffentliche Raum der europäischen Stadt vergangener Jahrhunderte geplant werden könnte. Er hat die Qualität des Kochrezeptes einer köstlichen Speise, in dem zwar alle Zutaten aufgezählt werden, in dem aber der Kochvorgang nicht erläutert wird: Er ist ein Instrument planungstheoretischen Handelns, ohne dass daraus ein Stück europäischen Stadtraumes erwüchse.
Dies gilt auch, wenn der Aufstellung dieser Bebauungspläne ein städtebaulicher Wettbewerb vorangegangen ist, weil auch dieser sich nicht mit Straßen- und Platzräumen auseinandersetzt, sondern sich vielmehr in zweidimensionalen Planungen mit modisch mäandrierenden Baukörpern, gewürfelten Häuschen und vor allem viel Grün beschäftigt.
Besonders deutlich wird dieser Mangel, wo in einem Neubaugebiet öffentliche Gebäude, Schulen oder Kindergärten vorgesehen sind. Man nutzt diese in der Planung nicht, um diese Bauwerke als besonderen Ort eines Quartiers herauszuarbeiten. So könnte man ein solches öffentliches Gebäude seiner gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend beispielsweise, von einem Platz umgeben, in der zentralen Mitte eines Quartiers anordnen, so wie dies Ernst May mit der Pestalozzischule von Martin Elsässer in seiner Siedlung Bornheimer Hang in Frankfurt am Main von 1925 plante.
Derartige stadträumliche Höhepunkte sehen heutige Planungen nicht vor. Durchforstet man dagegen die Literatur zum europäischen Städtebau um die vorletzte Jahrhundertwende, liest man Josef Stübben, Raymond Unwin oder Cornelius Gurlitt, findet man praxisnahe Handlungsanweisungen, die sich auf der Grundlage funktional-technischer Gegebenheiten der damaligen Zeit so gut wie ausschließlich mit dem Entwurf des öffentlichen Raumes, seiner Proportion, seiner Enge und Weite und der Anordnung von Häusern an Straßen und Plätzen beschäftigen.
Grundelement des Entwurfs schöner städtischer Räume ist das städtische Wohn- und Geschäftshaus. Es ist eines der kleinsten Elemente, ein Stadtbaustein, mit dem städtischer Raum gebildet wird. „Die Außenwände des Wohnraumes sind die Innenwände des öffentlichen Stadtraumes“, definiert der Wiener Architekt und Stadtplaner Georg Franck treffend – die Fassaden der Wohn- und Geschäftshäuser formen die Straßen- und Platzräume. Folgerichtig muss sich die Grundform des Einzelhauses der Grundform der Straße und des Platzes unterordnen und nicht einfach nur, wie heute üblich, der einfachen Rechteckform folgen. Aber auch schon die Höhe eines Hauses, ins richtige Verhältnis zur Breite der Straße und ihrer Gehsteige gesetzt, bestimmt die Proportion und den Charakter des öffentlichen Raumes.
Die Ausrichtung des Grundrisses zur Straße hin ist bestimmend für die Anteilnahme der Bewohner am städtischen Straßenleben. Der Grundriss eines Mietshauses, an dessen Straßenfassade aus vermeintlich funktionalen Gründen ausschließlich Treppenhäuser, Bäder und Küchen gelegt sind, weil man glaubt, alle Wohnräume zur Sonne ausrichten zu müssen, verschließt sich der Straße. Das Haus wendet der Straße den Rücken zu. Die Schönheit der Fassade im städtischen Straßenraum wird also erst einmal durch die Grundrissorganisation des Hauses bestimmt. Die Stadthäuser Amsterdams, deren Wohnräume am Abend den öffentlichen Raum wie eine Theaterkulisse beleben, sind vielleicht das beste Beispiel, um das Verhältnis der Funktion von Wohnhausgrundrissen und ihren Einfluss auf den Straßenraum zu erläutern.
Voraussetzung für eine räumlich gefasste Straße ist die Orientierung der Hausfassaden, ihrer „Straßenfenster“ und Hauseingänge in den städtischen Raum. Aus dieser Orientierung, der Materialität, Farbigkeit und Proportion der Hausfassaden, wird die Schönheit des Straßenraumes entwickelt. Architektonisch kam der Hausfassade, auch als Straßenfassade bezeichnet, zu allen Zeiten eine besondere Bedeutung zu, weil sie das Haus für seinen Besitzer in den öffentlichen Raum hinein repräsentierte. Dies hat sich erst mit der Moderne und der Idee des Hauses als solitärem Kunstwerk verändert.
Kern der Misere: Die Verantwortlichen planen zumeist aneinander vorbei. Architekten entwerfen Einzelbauten in Form, Farbe und Material, so als gäbe es keinen Stadtraum, in den sie sich einzufügen hätten. Stadtplaner setzen vor allem Planungsprozesse auf, statt Stadträume zu entwickeln und zu zeichnen. Verkehrsplaner errechnen Verkehrsströme und legen Verkehrstrassen fest, statt Stadtstraßen zu planen. Tatsache ist, dass wir den Stadt- und Raumplaner seit den siebziger Jahren an vielen unserer Universitäten ohne stadträumliches Gestalten, also ohne den Entwurf von Straße und Platz und damit ohne die Lehre des Entwurfes von Stadtraum, ausbilden. An einigen Fakultäten wird in der Ausbildung zum Stadtplaner sogar ganz auf das Fach Architektur und Stadtbaugeschichte verzichtet. Ein Kuriosum – wie will man ein Stadtquartier planen, ohne zu wissen, wie ein Wohn- oder ein Bürohaus entworfen wird?
1908 schrieb der Kunsthistoriker A.E. Brinckmann den Architekten ins Stammbuch: „Es ist notwendig, dass Architekt und Publikum aufhören, den einzelnen Bau als ein in sich abgeschlossenes Gebilde zu betrachten. Jeder Bau hat eine Verpflichtung gegen seine Umgebung, gegen die gesamte Stadt, wie der Einzelne gegen seine Familie. Nicht Einzelnes allein zu sehen, sondern Relationen zu geben, dies ist das erste Bemühen des Stadtbaues. Unter Relationen verstehen wir das optisch aufgenommene, plastisch und räumlich empfundene Verhältnis der einzelnen Teile einer architektonischen Situation untereinander und zum Ganzen.“ – Wir sollten die Ausbildung der Architekten wieder an diesem Ganzen ausrichten.
Prof. Christoph Mäckler, Architekt und Stadtplaner, Direktor Deutsches Institut für Stadtbaukunst