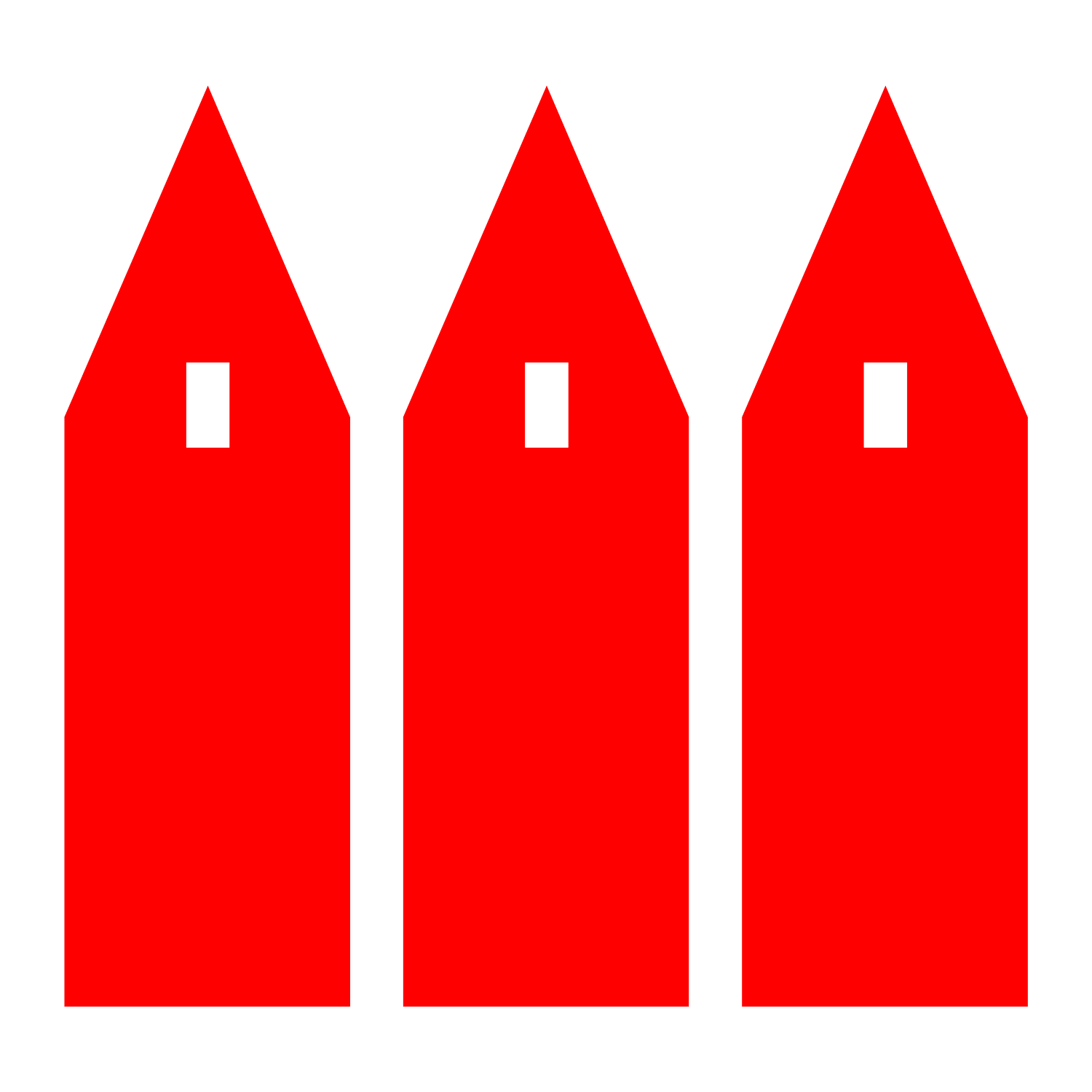Von Haus aus missglückt
FAZ Artikel, 1. September 2016
Bauherren und Architekten im Würgegriff des Bebauungsplans: Warum nur ist uns die Fähigkeit abhandengekommen, schöne und bewohnbare Städte zu bauen? Ein Denkanstoß.
Warum eigentlich sind unsere alten Städte in Europa schöner als alles, was Planer und Architekten je in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg an Neuem entwickelt haben? Ist das normal? Sind Städte, wie der eine oder andere Kritiker im Brustton der Überzeugung öffentlich vertritt, unplanbar? Oder beruht der desolate Zustand der neuen Stadtviertel mit ihren traurig-tristen Straßen, denen jede Anmutung und Aufenthaltsqualität fehlt, einfach nur auf einem fatalen Unwissen der Fachleute, Straßen und Plätze als städtische Aufenthaltsräume zu planen?
Offenbar haben wir uns daran gewöhnt, dass wir, wenn von Florenz als schöner Stadt die Rede ist, nicht die Neubauviertel der vergangenen fünfzig Jahre, sondern ausschließlich vom Zentrum der Stadt mit der Piazza della Signoria sprechen. Wer Barcelona als die schönste Stadt am Meer benennt, meint die alte Rasterstadt mit dem prächtigen Boulevard, den Ramblas und nicht die Erweiterung der Stadt, wie sie von Planern für Olympia 1992 mit einem Etat von 5,5 Milliarden Euro angelegt wurde.
Und wenn wir von Paris schwärmen, haben wir das Paris Haussmanns vor Augen und nicht das von 1963 an entstandene Viertel La Défense hinter dem Arc de Triomphe oder gar die Banlieues, jene Neubauviertel außerhalb des Stadtzentrums, die zum Inbegriff sozialen Abstiegs mutierten. Und natürlich haben die Demonstrationen gegen die Anschläge auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ auch nicht in diesen neuen Vierteln, sondern auf dem Place de la République stattgefunden.
Und wenn wir durch die von Planern angepriesenen neuen Stadtviertel hinter den Bahnhöfen von Stuttgart, Zürich, oder Frankfurt gehen, die ihre Urbanität und Zukunftsfähigkeit glauben schon mit ihrem Namen „Europaviertel“ nachweisen zu können, fröstelt es uns angesichts der abstoßenden Kälte und Langeweile, die uns in den ungefassten Stadträumen entgegenschlägt. Genaugenommen sind es auch keine Stadträume, sondern Resträume, die zwischen den von Architekten geplanten und neuerrichteten Häusern erhalten bleiben, und von Landschaftsplanern mit gepflasterten Wegen, Kinderspielgeräten, Bänken, Büschen und Bäumen aufgefüllt werden, damit sie gegenüber dem Bürger in ihrer räumlichen Belanglosigkeit noch irgendwie zu rechtfertigen sind. Diese Europaviertel reichen qualitativ nicht im mindesten an die vormodernen, mehr als hundert Jahre alten Stadtzentren heran.
Ist das normal? Müssen Neubauviertel aus neben- und hintereinandergestellten Behausungen ohne jeden räumlichen Bezug zueinander, ohne einen von Architekten entworfenen öffentlichen Stadtraum entstehen? Oder sind wir einfach nur Ewiggestrige, die wir es wagen, das Nichtvorhandensein des öffentlichen Raumes in städtebaulicher Qualität in unseren Neubauvierteln anzumahnen? Der derzeit landauf, landab zu beobachtende Wiederaufbau von alten Häusern und Quartieren jedenfalls scheint eigentlich nur der Hilfeschrei einer Gesellschaft zu sein, die von Planern und Architekten andere Qualitäten erwartet als das, was wir ihr in den letzten Jahrzehnten angeboten haben. Während die hohe Nutzungsmischung und die Dichte der Stadt, wie wir sie in den Vierteln des neunzehnten Jahrhunderts finden, in der Fachwelt mittlerweile eine weitgehend anerkannte Grundregel für die Planung eines neuen Quartiers darstellen, findet der architektonische Teil der Planung, der Entwurf des öffentlichen Raumes, des Straßen- und Platzraumes in Planer- und Architektenkreisen noch immer keine Anerkennung oder ist zumindest umstritten.
Dabei ist der öffentliche Raum der Stadt schlechthin der Gemeinschaftsbesitz unserer Gesellschaft. Der öffentliche Raum ist eine der größten Errungenschaften der alten europäischen Stadt. Hier traf man sich, um Ideen, Meinungen und Informationen auszutauschen. Vor allem aber kann dieser öffentliche Raum, im Gegensatz zu den bewachten sogenannten Gated Communities, von jedem Stadtbürger als Aufenthaltsraum genutzt werden, unabhängig von Herkunft, Position und sozialem Status.
Anders als der private Wohnraum des Hauses aber, in dem wir die Wandfarbe, den Teppich, das Parkett und den Sessel sorgfältig aussuchen, um uns wohl zu fühlen, bleibt die Gestalt des Straßen- und Platzraumes in unseren Stadtplanungsämtern ungeplant. Sie wird der Willkür und dem Unwissen einer privatwirtschaftlich orientierten Bauherrenschaft überlassen, die ihrerseits aber an der Schönheit des Quartiers interessiert ist, um damit eine bessere Vermarktung der jeweiligen Immobilie herbeiführen zu können. Denn der öffentliche Raum ist – mit einem Wort des Architekten und Kunsthistorikers Cornelius Gurlitt von 1920 – als erweiterter Wohnraum zu sehen.
Fakt ist, dass die Moderne europaweit nicht einen einzigen Platzraum hervorgebracht hat, der in seiner stadträumlichen Qualität mit dem Place des Vosges, der Piazza Navona oder auch nur mit dem unter dem damaligen Oberbürgermeister Walter Wallmann schon 1983 wiedererrichteten Rathausplatz der Stadt Frankfurt, dem Römerberg mit seinen giebelständigen Fachwerkhäusern, vergleichbar wäre. Noch im neunzehnten Jahrhundert aber finden sich diese stadträumlichen Qualitäten im Städtebau. Namen von Städtebauern wie Josef Stübben in Köln, Theodor Fischer in München oder Fritz Schumacher in Hamburg stehen beispielhaft für gelungene Stadträume, in denen sich die Bewohner noch wohl fühlen.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Städtebau in Deutschland ausschließlich gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen zu dienen hat, und uns gleichzeitig vergegenwärtigen, dass die auf dem Immobilienmarkt begehrtesten Stadtgebiete nicht etwa unsere heutigen Neubauviertel sind, sondern vor mehr als hundert Jahren realisierte Stadtentwürfe, wird deutlich, dass der öffentliche Raum eine architektonisch-städtebauliche Dimension hat, die es in unseren Stadtplanungsämtern wieder aktiv zu bearbeiten gilt.
Die Immobilienpreise zeigen, welchen Mehrwert ein altes Stadtquartier gegenüber einem Neubaugebiet hat. Ein Mietshaus aus dem Jahre 1886 stellt in einer Stadt wie Köln, Frankfurt, München oder Berlin einen weit wertvolleren Besitz dar, als ein vergleichbares Haus des Jahrgangs 1986. Das liegt aber nicht an der wiedererwachten Vorliebe unserer Gesellschaft für die Fassadenstuckaturen des neunzehnten Jahrhunderts, sondern ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass dieses Haus in einem Stadtquartier mit architektonisch gefassten öffentlichen Räumen, an Straßen und Plätzen dieser Zeit steht. Die Qualität alter Stadträume ist nicht irgendwie gewachsen, sondern dem städtebaulichen Entwurf der damaligen Zeit geschuldet.
Und natürlich findet die sogenannte Gentrifizierung nicht in Neubauvierteln oder in den Siedlungsgebieten der achtziger und neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern in erster Linie in den alten Stadtquartieren des neunzehnten Jahrhunderts statt. Der Immobilienmarkt macht uns also deutlich, dass die beliebtesten Stadtquartiere aus der Zeit der Erfindung des Automobils stammen. Würden wir heute aber mit einem Automobil dieser Zeit von München nach Hamburg fahren? Weder funktional noch ästhetisch entspricht es unseren heutigen Ansprüchen. Anders verhält es sich mit der Schönheit des städtischen Raumes dieser Zeit, die wir nicht als museal, sondern als zeitgemäße Wohnumgebung von höchster Qualität empfinden.
Wenn wir Architekten und Planer uns selbst in alten Stadtquartieren wohler fühlen als in den von uns konzipierten Neubauvierteln, warum versuchen wir diese stadträumlichen Qualitäten nicht in unsere Zeit zu transferieren? Warum lösen wir die Gentrifizierung statt mit politisch verordnetem Mietpreisstopp nicht mit der Errichtung von neuen Stadtquartieren der gleichen Qualität?
Heute stehen am Beginn einer Quartiersplanung technische Planungen. Man beginnt mit der Verkehrstechnik, der Trassenbreite von Straßen, ihren Abbiegespuren und weißen Verkehrsmarkierungen, statt den architektonisch stadträumlichen Charakter der Straße an den Anfang des Entwurfes eines Stadtquartiers zu stellen. Man beginnt mit theoretischen Planungen von städtischer Dichte statt mit dem konkreten Entwurf von städtischem Raum. Man stellt Häuser in mathematischen Verhältniszahlen von Gebäude- zu Grundstücksgröße zusammen, ohne Straßen und Plätze mit räumlich erlebbaren Proportionen als öffentliche Stadträume zu entwerfen.
Der zeitgenössische Bebauungsplan zeigt mit seinem Zahlenwerk dem Betrachter nicht, wie die Häuser zueinander stehen, um miteinander einen gemeinsamen Raum, einen Straßen- oder Platzraum zu bilden. Er ist kein Instrument, mit dem der öffentliche Raum der europäischen Stadt vergangener Jahrhunderte geplant werden könnte. Er hat die Qualität des Kochrezeptes einer köstlichen Speise, in dem zwar alle Zutaten aufgezählt werden, in dem aber der Kochvorgang nicht erläutert wird: Er ist ein Instrument planungstheoretischen Handelns, ohne dass daraus ein Stück europäischen Stadtraumes erwüchse.
Dies gilt auch, wenn der Aufstellung dieser Bebauungspläne ein städtebaulicher Wettbewerb vorangegangen ist, weil auch dieser sich nicht mit Straßen- und Platzräumen auseinandersetzt, sondern sich vielmehr in zweidimensionalen Planungen mit modisch mäandrierenden Baukörpern, gewürfelten Häuschen und vor allem viel Grün beschäftigt.
Besonders deutlich wird dieser Mangel, wo in einem Neubaugebiet öffentliche Gebäude, Schulen oder Kindergärten vorgesehen sind. Man nutzt diese in der Planung nicht, um diese Bauwerke als besonderen Ort eines Quartiers herauszuarbeiten. So könnte man ein solches öffentliches Gebäude seiner gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend beispielsweise, von einem Platz umgeben, in der zentralen Mitte eines Quartiers anordnen, so wie dies Ernst May mit der Pestalozzischule von Martin Elsässer in seiner Siedlung Bornheimer Hang in Frankfurt am Main von 1925 plante.
Derartige stadträumliche Höhepunkte sehen heutige Planungen nicht vor. Durchforstet man dagegen die Literatur zum europäischen Städtebau um die vorletzte Jahrhundertwende, liest man Josef Stübben, Raymond Unwin oder Cornelius Gurlitt, findet man praxisnahe Handlungsanweisungen, die sich auf der Grundlage funktional-technischer Gegebenheiten der damaligen Zeit so gut wie ausschließlich mit dem Entwurf des öffentlichen Raumes, seiner Proportion, seiner Enge und Weite und der Anordnung von Häusern an Straßen und Plätzen beschäftigen.
Grundelement des Entwurfs schöner städtischer Räume ist das städtische Wohn- und Geschäftshaus. Es ist eines der kleinsten Elemente, ein Stadtbaustein, mit dem städtischer Raum gebildet wird. „Die Außenwände des Wohnraumes sind die Innenwände des öffentlichen Stadtraumes“, definiert der Wiener Architekt und Stadtplaner Georg Franck treffend – die Fassaden der Wohn- und Geschäftshäuser formen die Straßen- und Platzräume. Folgerichtig muss sich die Grundform des Einzelhauses der Grundform der Straße und des Platzes unterordnen und nicht einfach nur, wie heute üblich, der einfachen Rechteckform folgen. Aber auch schon die Höhe eines Hauses, ins richtige Verhältnis zur Breite der Straße und ihrer Gehsteige gesetzt, bestimmt die Proportion und den Charakter des öffentlichen Raumes.
Die Ausrichtung des Grundrisses zur Straße hin ist bestimmend für die Anteilnahme der Bewohner am städtischen Straßenleben. Der Grundriss eines Mietshauses, an dessen Straßenfassade aus vermeintlich funktionalen Gründen ausschließlich Treppenhäuser, Bäder und Küchen gelegt sind, weil man glaubt, alle Wohnräume zur Sonne ausrichten zu müssen, verschließt sich der Straße. Das Haus wendet der Straße den Rücken zu. Die Schönheit der Fassade im städtischen Straßenraum wird also erst einmal durch die Grundrissorganisation des Hauses bestimmt. Die Stadthäuser Amsterdams, deren Wohnräume am Abend den öffentlichen Raum wie eine Theaterkulisse beleben, sind vielleicht das beste Beispiel, um das Verhältnis der Funktion von Wohnhausgrundrissen und ihren Einfluss auf den Straßenraum zu erläutern.
Voraussetzung für eine räumlich gefasste Straße ist die Orientierung der Hausfassaden, ihrer „Straßenfenster“ und Hauseingänge in den städtischen Raum. Aus dieser Orientierung, der Materialität, Farbigkeit und Proportion der Hausfassaden, wird die Schönheit des Straßenraumes entwickelt. Architektonisch kam der Hausfassade, auch als Straßenfassade bezeichnet, zu allen Zeiten eine besondere Bedeutung zu, weil sie das Haus für seinen Besitzer in den öffentlichen Raum hinein repräsentierte. Dies hat sich erst mit der Moderne und der Idee des Hauses als solitärem Kunstwerk verändert.
Kern der Misere: Die Verantwortlichen planen zumeist aneinander vorbei. Architekten entwerfen Einzelbauten in Form, Farbe und Material, so als gäbe es keinen Stadtraum, in den sie sich einzufügen hätten. Stadtplaner setzen vor allem Planungsprozesse auf, statt Stadträume zu entwickeln und zu zeichnen. Verkehrsplaner errechnen Verkehrsströme und legen Verkehrstrassen fest, statt Stadtstraßen zu planen. Tatsache ist, dass wir den Stadt- und Raumplaner seit den siebziger Jahren an vielen unserer Universitäten ohne stadträumliches Gestalten, also ohne den Entwurf von Straße und Platz und damit ohne die Lehre des Entwurfes von Stadtraum, ausbilden. An einigen Fakultäten wird in der Ausbildung zum Stadtplaner sogar ganz auf das Fach Architektur und Stadtbaugeschichte verzichtet. Ein Kuriosum – wie will man ein Stadtquartier planen, ohne zu wissen, wie ein Wohn- oder ein Bürohaus entworfen wird?
1908 schrieb der Kunsthistoriker A.E. Brinckmann den Architekten ins Stammbuch: „Es ist notwendig, dass Architekt und Publikum aufhören, den einzelnen Bau als ein in sich abgeschlossenes Gebilde zu betrachten. Jeder Bau hat eine Verpflichtung gegen seine Umgebung, gegen die gesamte Stadt, wie der Einzelne gegen seine Familie. Nicht Einzelnes allein zu sehen, sondern Relationen zu geben, dies ist das erste Bemühen des Stadtbaues. Unter Relationen verstehen wir das optisch aufgenommene, plastisch und räumlich empfundene Verhältnis der einzelnen Teile einer architektonischen Situation untereinander und zum Ganzen.“ – Wir sollten die Ausbildung der Architekten wieder an diesem Ganzen ausrichten.
Prof. Christoph Mäckler, Architekt und Stadtplaner, Direktor Deutsches Institut für Stadtbaukunst